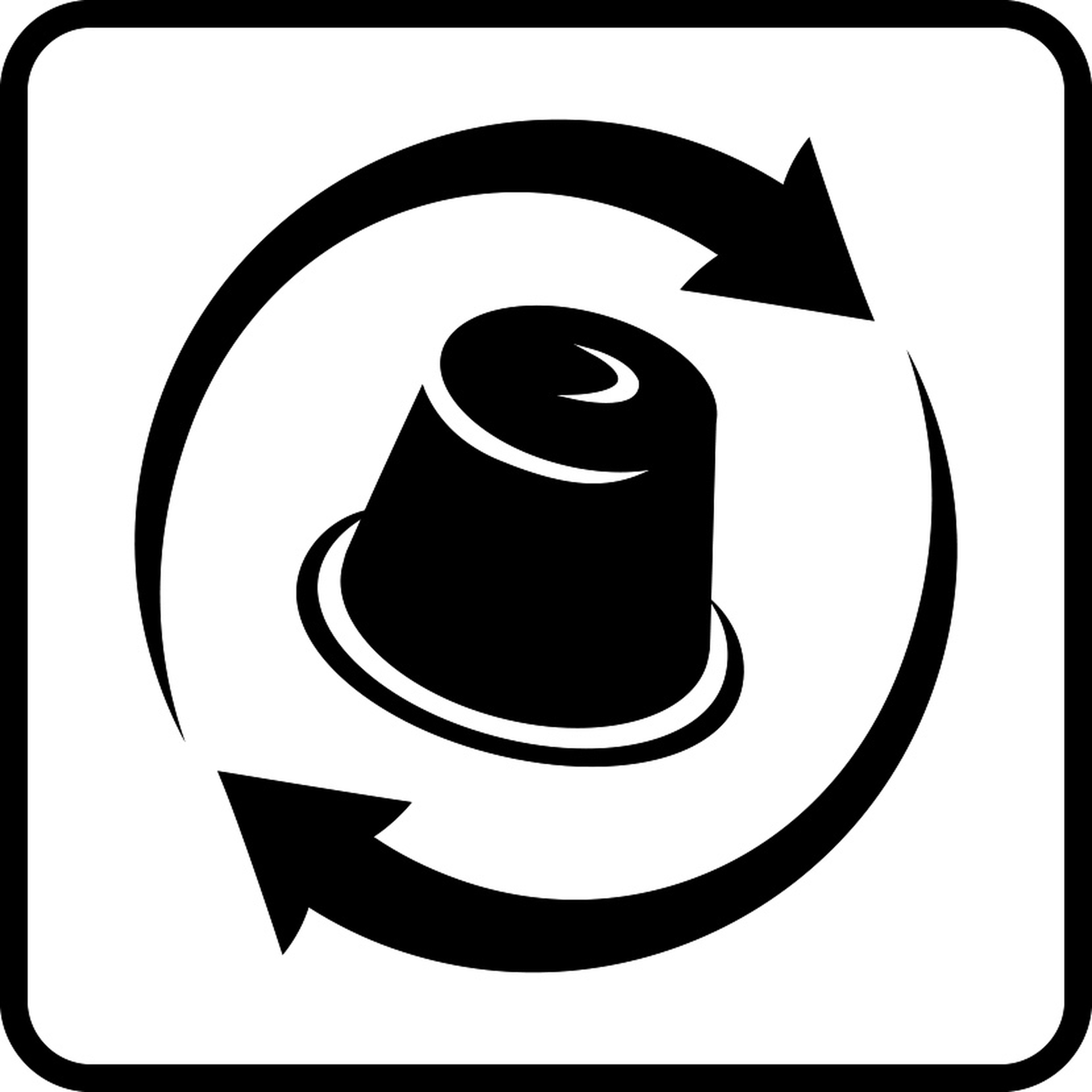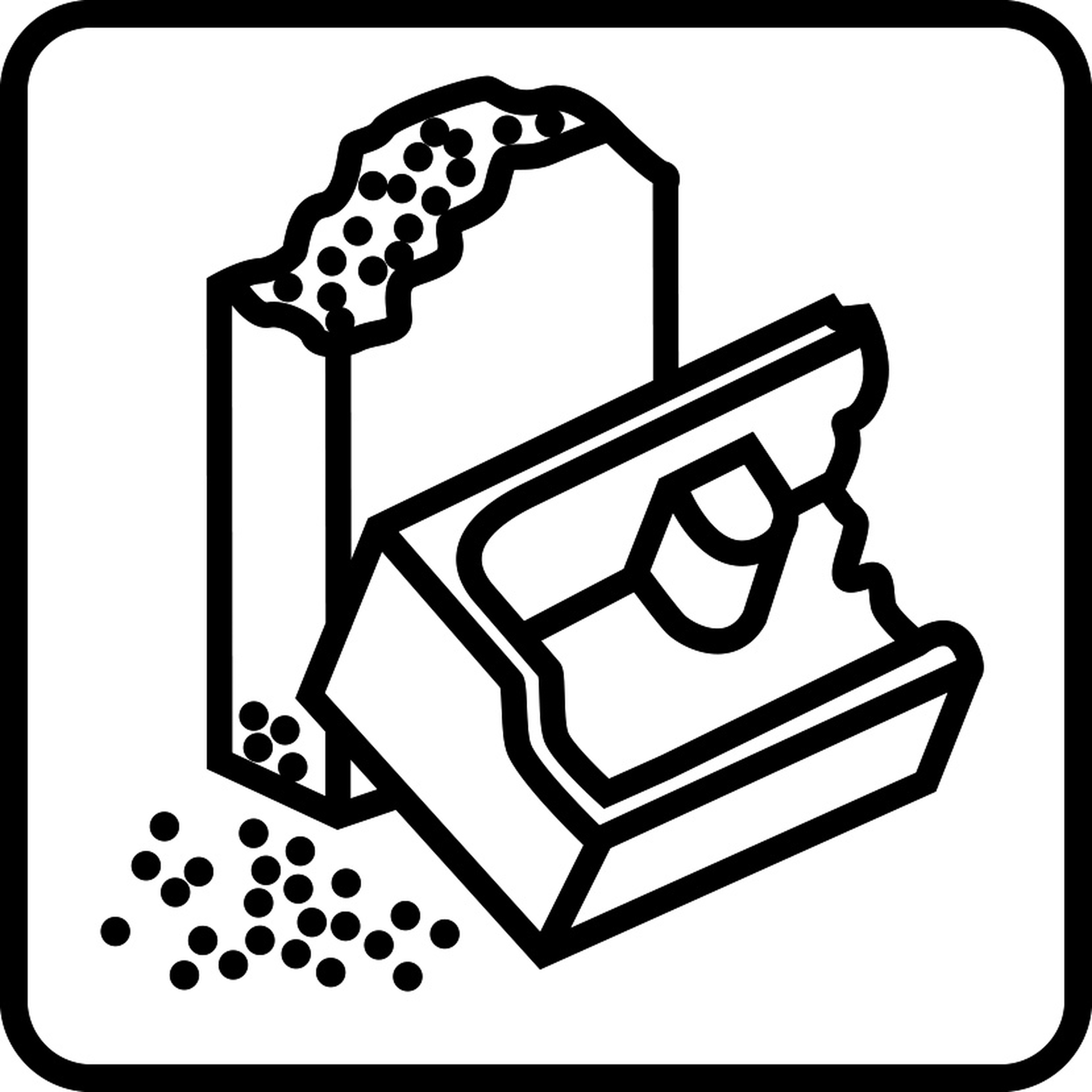Recycling-Symbole 101: Teil 3
Du hast bestimmt schon mal ein Symbol auf einer Verpackung gesehen und dich gefragt: Muss das jetzt in den Kehricht oder in den Sammelcontainer? Genau hier helfen Recycling-Symbole – und wir zeigen dir in dieser Serie, was sie bedeuten.
Was ist ein Recycling-Symbol / Piktogramm überhaupt?
Hast du schon mal auf einer Verpackung ein Dreieck mit Pfeilen gesehen? Oder eine kleine Figur, die etwas in einen Kübel wirft? Das sind sogenannte Recycling-Piktogramme – kleine Symbole, die uns zeigen, wie ein Produkt oder eine Verpackung wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Sie helfen dabei, Abfälle korrekt zu trennen, damit möglichst viele wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben können. Manche Symbole zeigen das Material an, andere erklären, wer für das Recycling bezahlt oder was nicht hinein gehört. Kurz gesagt: Sie sind der Spickzettel für den Recycling-Alltag.
Das Symbol zeigt ein Hemd und einen Schuh, bezieht sich jedoch auf jegliche Altkleider und Altschuhe. Die unterschiedlichen Sammelorganisationen in der Schweiz (z.B. TEXAID, Tell-Tex), geben vor, welche Textilien in die Sammlung gehören. Auch Heimtextilien, z.B. Duvetbezüge oder Kissen, dürfen in der Textilsammlung mit gesammelt werden. Alttextilien können an diversen Sammelpunkten oder an Sammelstellen zurückgegeben werden. Gewisse Modeketten nehmen ihre eigenen Kleider auch kostenlos zurück.
Durch schnelle Modetrends landen selbst gut erhaltene Kleider viel zu früh in der Sammlung. Nur etwa 30 % können direkt wieder getragen werden – Tendenz sinkend. Dafür verantwortlich sind die Fast-Fashion-Trends: Die Qualität der Kleidung ist miserable und somit können Kleider nicht mehr als Kleider wiedervendet werden, sondern landen im schlimmsten Fall direkt in der Verbrennung.
Früher deckte der Erlös aus Second-Hand-Verkauf die Sammelkosten. Heute reicht das nicht mehr – zu viele Kleider sind unbrauchbar. Politisch wird die Einführung eines vorgezogenen Recycling-Beitrages diskutiert. Das könnte eine effiziente Sammlung langfristig sichern. Mit den aktuellen Entwicklungen steht die Textilrecyclingbranche vor Herausforderungen, die kaum zu bewältigen scheinen.
Das Symbol zeigt eine Kapsel aus Aluminium, wie sie von diversen Kaffeekapselherstellern angeboten werden (z.B. Nespresso®). Die Kapseln werden in den Verkaufsläden (z.B. Coop und Migros) und an freiwilligen Sammelstellen zurückgegeben. Da die Kapseln nicht als Getränkeverpackung gelten, unterliegen sie keiner gesetzlichen Sammelpflicht.
Die Kapseln werden gesammelt und in einer ausgeklügelten Sortier- und Aufbereitungsanlage in der Westschweiz zerkleinert. Der Kaffeesatz wird vom Aluminium getrennt, Kunststoffe und Fehlwürfe werden aussortiert. Das Aluminium wird zu Paketen gepresst und kann so wieder in den Aluminium-Kreislauf, während der Kaffeesatz zu Biodiesel oder Dünger verarbeitet wird.
Auch wenn es nach wenig aussieht: Eine Tonne gesammelter Alukapseln spart so viel CO₂ wie 30 Autofahrten von Zürich nach Barcelona – beeindruckend, oder?
Die Sammlung wird vom SACR (Swiss Aluminum Capsule Recycling) finanziert. Gestartet hat das Sammelsystem Nespresso. Unterdessen sind jedoch auch weitere Hersteller und Vertreiber dem Verein beigetreten, zuletzt 2022 Tchibo und Starbucks.
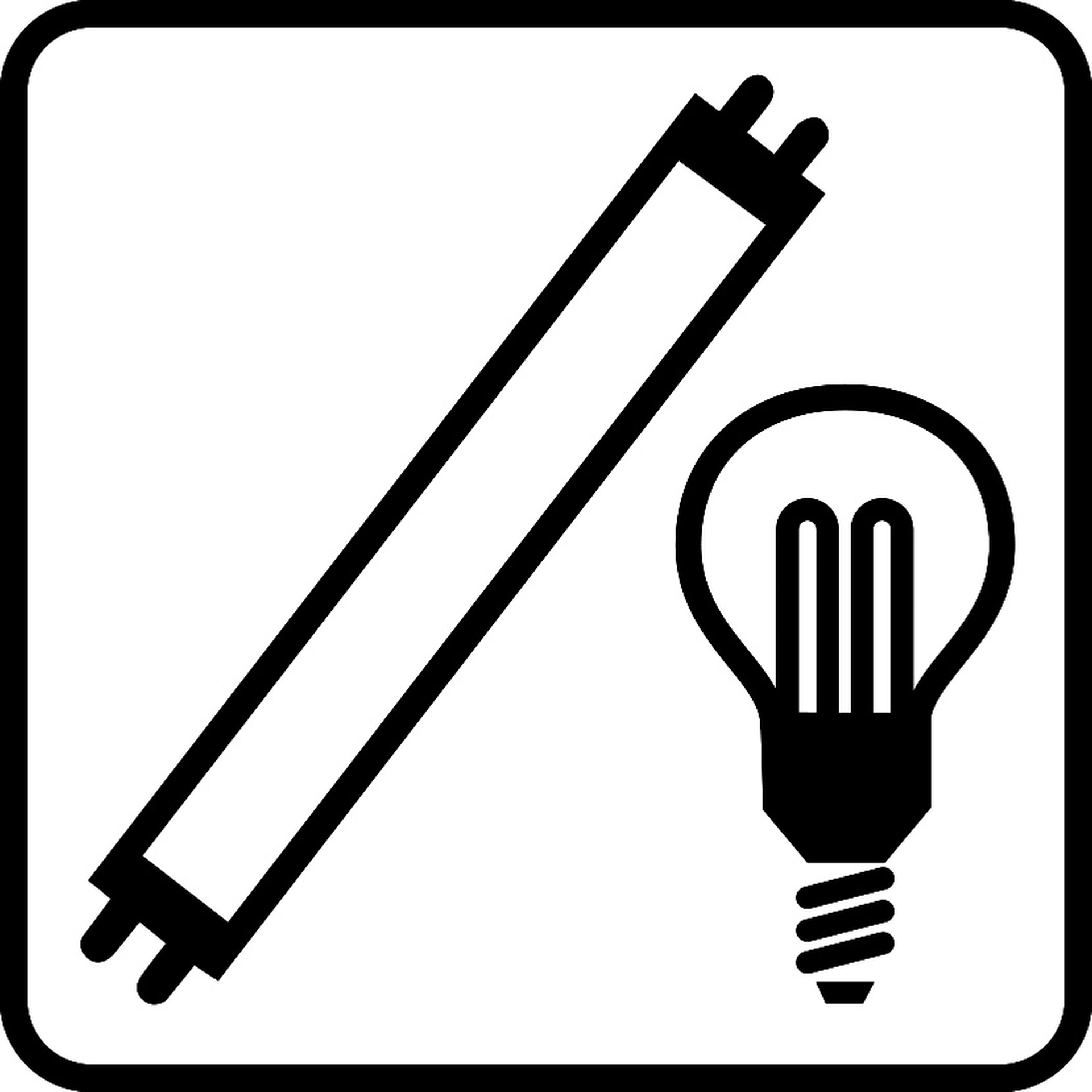
Auf diesem Piktogramm sind Leuchtmittel zu sehen – herkömmliche Glühbirnen und stabförmige Leuchten. Die Effizient der Leuchten und hat in den letzten zehn Jahren enorm zugenommen. Auf dem Weg von den herkömmlichen Glühbirnen zu modernen LED-Leuchten sind diverse Technologien auch bereits wieder verschwunden. Im Recycling werden diese Leuchtmittel nun nach und nach angeliefert.
Die Leuchtmittel werden an öffentlichen Sammelstellen und an Verkaufsstellen zurückgenommen und gesammelt. Nach der manuellen Sortierung nach Technologie und Form werden die Leuchten unterschiedlich weiterverarbeitet. Glühbirnen und Verpackungen gehen in den Kehricht, während die anderne Leuchten je nach Inhaltsstoff einem spezialisierten Recyclingverfahren zugeführt werden. Nach der Entfrachtung von Schadstoffen werden die Leuchten in ihre einzelnen Materialbestandteile aufgetrennt und so dem Rohstoffkreislauf zugeführt.
Die Sammlung wird von der Stiftung SENS eRecycling über einen vorgezogenen Recyclingbeitrag (vRB) finanziert.

Medikamente, Farben, Kosmetika, Reinigungsmittel oder Quecksilberhaltige Thermometer: Die Liste der Sonderabfälle ist lang. Sonderabfälle, welche unbehandelt in die Umwelt gelangen, können sowohl für Tiere, als auch für Menschen gefährlich sein. Sonderabfälle können je nach Kanton und Gemeinde an öffentlichen Sammelstellen zurückgegeben werden. Auch Verkaufsstellen nehmen die Abfälle meist entgegen (z.B. Apotheken für Medikamente).
In die Sammlung gehören jegliche Chemikalien, insbesondere wenn Gefahrensymbole auf der Verpackung aufgedruckt sind. Auch Lösungsmittel, Farben, Lacke, Verdünner oder Pflanzenschutzmittel sind Sonderabfälle. Sonderabfälle dürfen keinesfalls im Kehricht oder im Abwasser entsorgt werden.
Die Finanzierung der Sonderabfallsammlung obliegt den Kantonen und wird überall anders geregelt. Der Kanton Zürich z.B. bietet ein Sonderabfallmobil an, wo die Bevölkerung an gewissen Tagen ihre Sonderabfälle abgeben kann. Andere Sammelstellen verlangen einen Preis pro Kilogramm.
Styropor (EPS, expandiertes Polystyrol oder Sagex) wird aus Erdöl hergestellt. Mit den Lufteinschlüssen von 98% ist das Material sehr wärmedämmend und braucht wenig Rohmaterial. Zudem ist Styropor stoss- und schalldämmend und ist daher aus der Bau- und Verpackungsindustrie nicht mehr wegzudenken.
Die Sammlung ist nicht obligatorisch. Der Verband epsSwiss koordiniert jedoch die Sammelaktivitäten. Diverse Sammelstellen nehmen Styropor kostenpflichtig entgegen. In die Sammlung gehört jedoch nur weisses, sauberes Material, keine Nahrungsmittelverpackungen, keine Klebstoffe.
Das Material wird anschliessend entweder geshredddert oder gepresst, um das Volumen zu reduzieren und die Transporte zu optimieren. Danach kann Styropor eins zu eins wieder als Rohstoff in die Styropor-Produktion fliessen.